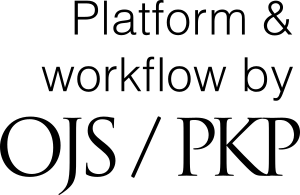Das Dortmunder Museum am Ostwall von Leonie Reygers
DOI:
https://doi.org/10.60857/archimaera.6.139-55Schlagworte:
Arnold Bode, Bürgerinitiative, Denkmal, Dortmund, Friedrich Kullrich, Gustav Knoblauch, Hans Döllgast, Jürg Steiner, Kriegsruine, Kunstmuseum, Leonie Reygers, Museumsbau, Nachkriegsmoderne, Oberbergamt, Otto Bartning, Umbau, Umnutzung, Weiterbauen, Wiederaufbau, Willem SandbergAbstract
In der europäischen Museumslandschaft der Nachkriegszeit war das Dortmunder Museum am Ostwall eine feste Größe. Gründungsdirektorin Leonie Reygers holte die weite Welt in die vom Bombenkrieg verwüstete Industriestadt. Sie übernahm 1947 eine ruinöses Haus, das bereits Resultat eines Umbaus war: das 1872–75 errichtete Königliche Oberbergamt war 1911 zum Museum für Kunst und Gewerbe umgebaut worden. Reygers entwickelte die Kriegsruine als Direktorin und gestaltende Bauherrin zu einem Museum der Gegenwartskunst weiter und strebte danach, in der Kombination von Alt und Neu eine „harmonische Atmosphäre“ entstehen zu lassen. Die verschiedenen historischen Schichten wurden unter ihrer Regie zu einer neuen Einheit verschmolzen. Das aus heutiger Perspektive eher unscheinbar wirkende Haus ist eines der ganz wenigen Zeugnisse eines Museumsbaus der unmittelbaren Nachkriegszeit in Deutschland und zudem ein exemplarisches Beispiel für die architektonische Strategie des Einfügens im Umgang mit Kriegsruinen.
Downloads
Veröffentlicht
2015-09-15
Ausgabe
Rubrik
Artikel